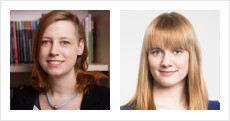Was macht Lernen mit digitalen Medien erfolgreich? Digitale Spiele in der Hochschule
12.10.2017: Der durchschnittliche Jugendliche erreicht bis zum Alter von 21 Jahren 10.000 Stunden Spielzeit – das Äquivalent der gesamten Sekundarstufen I und II. Dabei stellen sich Spielende freiwillig herausfordernden Aufgaben, lernen Taktiken und Regeln auswendig und investieren viel Zeit in ihr Hobby. Vermehrt beschäftigen sich Forschende mit diesem Phänomen und darauf aufbauenden Fragen – warum motivieren digitale Spiele und wie lässt sich diese Motivation beispielsweise für Lehre und Lernen nutzen?
Digitale Spiele sind ein zentrales Leitmedium des 21. Jahrhunderts und längst ein populärkulturelles Phänomen. Ein Großteil der Bevölkerung spielt regelmäßig digitale Spiele – bei jüngeren Generationen steigt die Quote auf bis zu 94 %. Die bekannte Forscherin und Spieleentwicklerin Jane McGonigal errechnete, dass der durchschnittliche Jugendliche bis zum Alter von 21 Jahren 10.000 Stunden Spielzeit erreicht – das Äquivalent der gesamten Sekundarstufen I und II. Dabei stellen sich Spielerinnen und Spieler freiwillig herausfordernden Aufgaben, lernen Taktiken und Regeln auswendig und investieren viel Zeit in ihr Hobby. Für die Wissenschaft stellt sich vermehrt die Frage, wie das motivierende Potenzial von digitalen Spielen für spiel-ferne Zwecke genutzt werden kann. Gamification – die Verwendung von Spiel- und Game-Design-Elementen in spielefernen Kontexten - und Serious Games rücken dabei immer stärker auch in den Fokus von Lehrenden, die sich davon eine Verbesserung und Modernisierung der Bildung erhoffen. Doch auch kommerziell erfolgreiche digitale Spiele lassen sich ebenso wie andere klassische Medien auf vielfältige Weisen im Bildungskontext nutzen.
Die Online-Kompetenzplattform Digitale-Spielewelten.de setzt an dieser Stelle an. Sie bietet interessierten pädagogischen Fachkräften kostenlos Projektbeispiele, Methoden und Materialien, die Einsatzmöglichkeiten und Facettenreichtum digitaler Spiele in der Bildung aufzeigen. Eigene Arbeiten und Methoden können dort ebenfalls niedrigschwellig mit anderen Nutzerinnen und Nutzern geteilt werden.
Maike Groen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH Köln am Institut Spielraum. Sie ist unter anderem medienpädagogisch verantwortlich für die Plattform Digitale-Spielewelten.de und promoviert über e-Sport als digitale Jugendkultur. Vor ihrem wissenschaftlichen Werdegang war sie mehrere Jahre in der außerschulischen Jugendbildungsarbeit aktiv.
Carolin Wendt arbeitet als Projektmanagerin bei der Stiftung Digitale Spielekultur. Dort ist sie verantwortlich für die Netzwerk- und Koordinationsarbeit sowie das Magazin der Plattform Digitale-Spielewelten.de. Darüber hinaus arbeitet sie im Awardbüro des Deutschen Computerspielpreises beim Einreichungs- und Juryprozess mit. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin (M.A.) und Germanistin (B.A.).
Zur Audio-Version des Interviews im e-teaching.org-Podcast.
Das Interview in voller Länge:
Zum Telefoninterview bei e-Teaching.org begrüße ich heute ganz herzlich Frau Carolin Wendt von der „Stiftung Digitale Spielekultur“ aus Berlin und Frau Maike Groen von der Technischen Hochschule Köln. Sie beide arbeiten im Projekt „Digitale Spielewelten“ mit - das ist eine Onlinekompetenzplattform für Medienpädagogik in der digitalen Spielekultur. Meine erste Frage schließt dort gleich an: „Digitale Spielekultur“ das hört sich zunächst nach einem Freizeitkontext an. Vielleicht können Sie als Einführung in das Thema erläutern, was mit den Begriffen Gamification und Serious Games überhaupt gemeint ist.
Carolin Wendt: Es gibt keine klare und allgemein akzeptierte Definition, zumindest nach meinem Wissen, von Serious Games und Gamification. Das hängt ein bisschen davon ab, wen man fragt. Grob gesprochen sind Serious Games Spiele, die eine inhaltliche Zielstellung haben, die über die reine Unterhaltung hinausgeht. Das ist das, worauf ich mich zumindest mit anderen verständigen kann. Bei Gamification ist das eher so, dass es die Anwendung von klassischen Spielmechaniken und Spielinhalten auf spielferne Kontexte ist. Also beispielsweise Interface Design von Spielen in klassischen Ausbildungsanwendungen. Aber was uns ganz wichtig ist, ist, dass natürlich digitale Spiele einen Freizeitkontext haben. Da kommen sie her und da sollen sie auch bleiben. Aber auch kommerzielle Spiele eignen sich sehr gut als Bildungsgegenstand und als Bildungswerkzeug. Und unsere Arbeit knüpft auch da an, dass wir sagen, wenn Jugendliche und Studentinnen und Studenten mit Spielen in ihrem Alltag konfrontiert werden, ist es auch wichtig, sie bei diesen Spielen abzuholen.
Maike Groen: Was ich vielleicht betonen könnte, wäre genau diese Brücke von Serious Games. Wenn wir über Lernen durch Spielen oder Lernen mit Spielen reden, dann fällt eben oft der Begriff Serious Games - also als Lernspiel, als „Wie kann ich Mathe verbessern mit einem Mathespiel, dass mich belohnt, dass mir Auszeichnungen gibt?“. Und warum wir eben Digitale Spielewelten heißen oder Spielekultur heißen und nicht Serious Games ist eben, dass unser Fokus darauf liegt, zu sagen: Die natürliche Begeisterung für digitales Spiel, das Engagement, das Kinder und Jugendliche zeigen in diesem Bereich, können wir versuchen aufzugreifen und das auf andere Lernebenen übertragen. Wir können auch sowohl mit einfachen als auch mit hochwertig produzierten Spielen, die eigentlich nicht oft dezidiert für den Bildungskontext gemacht sind, gut arbeiten und dadurch Inhalte, Werte, aber auch kognitive oder motorische Fähigkeiten an Kinder und Jugendliche vermitteln.
Jetzt haben wir schon viel vom Bildungskontext gesprochen. Da würde ich einhaken, weil das uns von e-teaching.org natürlich besonders interessiert. Warum sind Sie denn überzeugt, dass gerade die Hochschullehre oder die Lehre insgesamt den Einsatz von Games nutzen sollte?
Maike Groen: Also wenn wir lernen und wenn wir durch Spiel lernen, ist es eigentlich so, dass man sehr strukturiert lernt. Beim Tennis lerne ich eine bestimmte Handbewegung - das heißt aber nicht, dass ich diese Handbewegung transferieren kann und dann auch andere Schlägerballspiele gut spiele. Wenn ich aber durch Spiele lerne, die einen wesentlich stärkeren Kontext von Freiwilligkeit und von Engagement haben, dann ist es im Regelfall so, dass ich den Transfer daraus mitnehme, den ich auch in anderen Bereichen einsetzen kann. Diese Form von Lernwirkung sieht man auch bei digitalen Spielen. Es gibt Studien darüber, dass sowas wie „Raving Rabbids“ die Lesefähigkeit von Jugendlichen, die unter Legasthenie leiden, erhöhen kann, also dass sie, weil sie das Spiel so stark motiviert, lesen lernen und das in einen anderen Kontext transferieren können. Außerdem bieten digitale Spiele einen Effekt oder eine Form von Medium, die anders ist, als wenn ich lese oder einen Film schaue. Durch die Interaktivität sind die Spielenden im Regelfall wesentlich stärker gefragt. Das bietet insbesondere im Bereich der digitalen Spielekultur, wo wir an Kommunikationskultur anschließen oder an ethische Fragen wie „Wie gehen wir miteinander um?“ oder „Wie gehen wir mit Minderheiten um in der Demokratie?“ sehr große Potenziale, Spiele sowohl als Diskussionsansatz zu nehmen, als auch darüber zu reflektieren, was uns da eigentlich gezeigt wird. Spiele können Dinge thematisieren, wie rassistische Ausgrenzung oder wie Frauenverachtung oder sexuelle Belästigung. Sie können aber auch Themen besprechen wie Depression, können einen Perspektivwechsel ermöglichen zum Thema „Warum flüchten Menschen?“. Und das kann wesentlich stärker auf alle jungen Menschen wirken, die sich in diesem Kontext bewegen, als wenn ich mit ihnen nur eine Dokumentation darüber sehe.
Carolin Wendt: Ich bin eher in der schulischen Bildung unterwegs, im Gegensatz zu Maike, die ja vor allem in der Hochschule arbeitet. In der Schule zumindest ist es so, dass sich das Lernen im Allgemeinen gewandelt hat und dass es viele Studien gibt, die sagen: Man soll eher lernerzentriert arbeiten, es soll kooperativ gelernt werden, es gibt eher projektbasierte Ansätze. Und genau das ist eigentlich das, was Spiele und Spielinhalte zu einem idealen Vermittler machen. Denn genau das sind sie ja: Sie sind lerner- und spielerzentriert, sie sind kooperativ und sind oft in Projektbasis nutzbar. Deswegen ist es vielleicht auch einfach eine Modernisierung des Lernens in den Schulen und Hochschulen.
Sie nannten gerade die Aspekte "spielerzentriert", "lernerzentriert" und "kooperativ". Wie ist das mit der Motivation? Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch noch ein besonderes Potenzial von digitalen Spielen liegt.
Carolin Wendt: Es gibt einen ganzen großen Blumenstrauß an Dingen an digitalen Spielen, die zur Motivation beitragen können. Das werden wir wahrscheinlich auch gar nicht umfassend erzählen können. Beispielsweise gibt es ein Autonomie- und Kompetenzerleben bei den Spielern. Vielleicht haben gerade Schülerinnen und Schüler oder Studierende, die sonst weniger Erfolge erleben, in Spielen Erfolge, die sie erleben können und bekommen sofortiges Feedback auf ihre Handlung und Entscheidung. Das ist etwas sehr Befriedigendes. Darüber hinaus kann man auch einfach Leistungen erbringen, mit anderen in den Wettbewerb steigen und wenn man dabei scheitert, ist das im Spiel etwas ganz Normales. „Trial and Error“ ist in Spielen selbstverständlich. Es gehört dazu, um sich zu verbessern. Im Gegensatz zu Prüfungssituationen, wo Scheitern ja automatisch negativ ist, kann man in Spielen aus seinen Fehlern lernen und sich immer weiter verbessern, was unheimlich motivierend ist. Darüber hinaus hat man gleichzeitig Kontrolle über das, was man tut, natürlich im Rahmen der Spielregeln. Man kann in einigen Spielen aber auch die volle Freiheit und Kreativität ausleben, was sonst auch einfach schwer fällt.
Maike Groen: Also diese Selbstwirksamkeitserfahrungen sind auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, dass diese auch Gründe für die hohe Motivation und Begeisterung sind. Ein Teil der Selbstwirksamkeitserfahrung ist auch, dass man Dinge in seinem eigenen Tempo machen kann. Ich bin nicht an eine bestimmte Schulklasse gebunden oder an bestimmte zeitliche Richtlinien, sondern ich kann Dinge immer wieder versuchen. Ich kann eigene Problemlösungsstrategien entwickeln, ich kann mir Hilfe von anderen Orten suchen und die anwenden. Ich kann mich selber einfach als kompetent erfahren und mir angepasst an meine Bedürfnisse eine Welt oder ein Thema erschließen. Das funktioniert eben nicht in einem Film, den ich vielleicht mal anhalten kann, wenn ich […] Tee kochen gehe, aber in dem ich nicht in dem Maße interagieren kann. Und insbesondere, wenn wir in den Bereich von komplexeren, teuren Spielen schauen, steckt die Selbstwirksamkeit mittlerweile auch in der Geschichte. Ich kann ganz starken Einfluss darauf nehmen, wie sich Charaktere verhalten, wie ich mich entwickele, welche Einstellung andere Personen im Spiel zu mir haben. Ich kann auch im wahrsten Sinne des Wortes mit Identitäten spielen und Schwächen, die ich in der realen Welt habe, partiell ausgleichen oder mich neu erproben, neue Sexualitäten erproben, neue Perspektiven entwickeln. Das ist gerade für Menschen, die sich in der Adoleszenz befinden, total spannend. Man muss schauen, was die Spielermotivation ist, was das Spiel und dessen Genre ist, und ob ich das alleine oder in der Gruppe spiele. Also diese drei Aspekte Motivation, Wirkung und Nutzen sind einfach immer sehr differenziert zu betrachten.
Carolin Wendt: Wenn sie gut gemacht sind, machen Spiele auch einfach Spaß. Man möchte vorankommen, man möchte das Spiel entweder meistern oder auch einfach mit anderen erleben. Dieser Spaß ist auch motivierend.
Gibt es empirische Nachweise, die diese ganzen Aspekte, die sie vorhin aufgezählt haben, auch belegen oder ist derzeit noch eher wenig über Spiele und deren Wirkung auf Lernprozesse bekannt?
Maike Groen: Die gibt es und die gibt es auch in sehr verschiedenen Bereichen. Die Forschung hat sich leider ja sehr lange auf die Frage „Machen Spiele aggressiv oder gewalttätig?“ konzentriert und da, meiner Meinung nach, relativ gute Forschungsansätze verfolgt. Aber mittlerweile gibt es sehr viele Studien, die sich mit der Frage des Sozialverhaltens beschäftigen, wie „Vereinsamen Spielende oder erlernen sie soziale Fähigkeiten?“ oder „Erlernen sie so etwas wie Kooperation, Teamplay, Fairplay?“. Es gibt außerdem Forschung qualitativer und quantitativer Herangehensweise aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Perspektiven zu der Frage "Was lernt wer aus digitalen Spielen?". Und da geht es zum Beispiel um die Frage, ob ich bei aggressiven oder gewalttätigen digitalen Spielen auch so etwas wie schnelles Denken oder taktisches Handeln lerne, und wenn ja, wie lange dieser Effekt anhält. Über das Erlernen der Lesefähigkeit wurde auch schon öfter debattiert. Dann gibt es auch einige Spiele, die teilweise für den Bereich gemacht sind, teilweise dafür adaptiert wurden. „Games for health“, also gesundheitsfördernde Spiele, zum Beispiel: Wie ist es eigentlich mit „Silver Gamers“, also Senioren, die spielen können und sich dadurch im Bereich Xbox oder Nintendo Wii Bewegungsfähigkeiten antrainieren? Können durch diese vielen Reize, die auf einen einprasseln, auch die kognitive Fähigkeiten, also die Prävention von Alzheimer betrieben werden? Auch dazu gibt es Studien. Also die Forschung ist sehr breit angelegt, auf jeden Fall. Teilweise natürlich mit unterschiedlich belastbaren Ergebnissen, also teilweise gibt es eine kleine Stichprobe oder man kann nur über das eine spezifische Spiel eine Aussage machen, man kann das also sehr selten verallgemeinern und sagen: "Alle digitalen Spiele, da lernt man was Positives bei". Aber auf jeden Fall gibt es da sehr spannende Sachen zum Thema.
Carolin Wendt: Als Ergänzung zu den Studien über die Hochschularbeit: Letztes Jahr habe ich eine Studie von der Süddänischen Universität gelesen, die [...] Virtual Reality-Simulationen für die Laborvorbereitung und die Arbeit mit Chemikalien im Labor vor der tatsächlichen praktischen Arbeit ihrer Biologie- und Chemiestudenten benutzen. Dazu wurden acht Studien rausgegeben, die aussagen, dass sich die Studenten und Studentinnen, die mit dieser VR-Simulation gearbeitet haben, durchweg besser und sicherer im Labor bewegt haben als die, die nicht damit gearbeitet haben. Selbst die Hochschulen arbeiten also auch selber mit Spielen oder mit Spieletechnologie und begleiten das dann auch wissenschaftlich.
Nun interessieren mich noch ein paar ganz praktische Aspekte. Auf Ihrer Kompetenzplattform Digitale-Spielewelten.de haben Sie ja für Lehrende kostenlos Projekte, Methoden und Materialien für den Einsatz von Spielen zur Verfügung gestellt. Was muss man da beachten? Wo sind spezielle Stolperfallen oder Risiken, deren man sich bewusst sein sollte?
Carolin Wendt: Allem voran muss man sich als Lehrkraft erstmal fragen, was man mit dem Einsatz von Spielen bewirken möchte und was am Ende das Ziel ist. Das Lernziel und das Spiel müssen zueinander passen. Es reicht nicht, wenn man sagt „Ihr könnt jetzt ein Spiel spielen!“ - so, wie früher kurz vor den Sommerferien der Fernseher in die Klasse gerollt wurde - und dann automatisch einen Lerneffekt erwarten. Spiele müssen natürlich pädagogisch gerahmt werden und unter anderem dafür ist unsere Plattform da. Dass wir Inhalte und Hintergrundinformationen anbieten, wie und in welcher Form sich welche Spiele nutzen lassen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch gewisse technische Hürden und Stolperfallen, die Lehrende berücksichtigen müssen. Gerade von Lehrkräften wissen wir, dass es oft so eine gewisse Befürchtung gibt, dass die Studierenden beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler professioneller im Umgang mit dem Medium sind und dass da die Expertinnen und Experten nicht auf ihrer Seite des Tisches sitzen, sondern dass sie sich auch blamieren können. Davor müssen sie eigentlich keine Angst haben und auch das versuchen wir ihnen zu vermitteln.
Maike Groen: Die Frage der technischen Voraussetzung ist, dass die Digitalisierung in den meisten Schulen noch nicht angekommen ist, was immer wieder ein großes Thema in den Medien ist. Das heißt, wir versuchen auf unserer Plattform zu sagen, dass es Spiele gibt, die vielleicht besonders populär sind, sodass die Jugendlichen oder die Studierenden diese Spiele schon zu Hause haben, oder dass sie ihre eigenen Geräte mit in die Schule bringen können, um einen Workaround zu schaffen, wie man mit digitalen Spielen in der Schule arbeiten kann, ohne dass die digitalen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Und teilweise empfehlen wir sogar diese Form des Flipped Classrooms, wo die Schülerinnen und Schüler auf einmal dem Lehrer etwas erklären können, was ja eine ganz klare Lebensweltorientierung ist. Zu sagen, ihr habt nicht nur Kompetenzen in der Frage von „Harry Potter“ und „Star Wars“, sondern ihr habt auch eine Medienkompetenz, wie zum Beispiel im Bereich Medienkritik und digitale Spiele. Also man kann das im Kleinen und im Großen denken, wie man Spiele integrieren kann. Ich glaube, was man wirklich bedenken muss, ist, dass es, je nachdem, welches Spiel man spielt, Vorurteile in der Bildungsinstitution aber auch bei Erziehungsberechtigten geben kann und man überlegen könnte, ob und inwiefern das vorher abgeklärt werden sollte, nicht nur im Rahmen von USK, sondern eben auch im Rahmen von „Wie kann ich Vorurteile abbauen?“ und wie kann ich sagen „Nein, gerade weil das so faszinierend ist, muss ich das mit den Schülern thematisieren“. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Stolpersteine, die wir auch versuchen, in den meisten Methoden immer darzustellen und zu sagen „Hier ist Flipped Classroom möglich", "Hier ist Bring your own device möglich", "Hier sind alternative Youtube Videos, die man sich ansehen kann, wenn man zum Beispiel nichts zur Verfügung hat". In den Projekten, die wir haben, berichten die Personen zu den durchgeführte Methoden auch „Ich habe das so und so angewendet, dabei gab es die und die Probleme, eventuell könnte es so und so besser laufen“. Insofern ist das, glaube ich, gar nicht so schwer, wenn man es erstmal ausprobiert.
Gibt es denn Fachbereiche, wo Sie jetzt sagen würden, dass sich der Einsatz von Medien besonders gut eignen würde? Denn tatsächlich unterscheiden sich die Inhalte und auch die Wissensformen, die überhaupt vermittelt werden sollen, sehr stark.
Carolin Wendt: Theoretisch würde ich mal ganz frech behaupten, dass sich alle Fachbereiche in irgendeiner Form dafür eignen mit digitalen Spielen in der Lehre zu arbeiten. Natürlich ist es, wie Maike schon erwähnt hat, oft so, dass Spiele gerade ethische Fragestellungen gut beleuchten können und dass es sich deswegen natürlich für die Philosophie oder auch andere Sozial- und Geisteswissenschaften tendenziell sehr gut eignet. Auch in den Sprachwissenschaften kann man sehr gut mit Spielen arbeiten, weil diese natürlich auch Geschichten erzählen, Charakterisierungen anbieten, weshalb man das da genauso gut benutzen könnte. Was uns natürlich sehr am Herzen liegt, sind die Lehramtsstudiengänge, weil es natürlich wichtig wäre, dass die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer schon im Studium damit konfrontiert werden, wenn sie später in der Schule mit digitalen Spielen arbeiten sollen.
Maike Groen: Frau Wendt und ich haben am Anfang ein bisschen kritisch über den Begriff Gamification und Serious Games geredet. Solche Spiele findet man auf unserer Plattform eigentlich nicht. Sie werden bei uns keine Methode finden, die sagt, dass das ein Mathe- oder Physik- oder Chemielernspiel ist, das sich für den Unterricht eignet. Ich bin mir sicher, dazu gibt es sehr gute Methoden und Spiele, die mir nur nicht bekannt sind, weil die für uns nicht aus dieser lebensweltorientierten Perspektive oder Spielekulturperspektive heraus spannend sind. Davon will ich überhaupt nicht abraten, aber das ist nicht die Plattform, die wir für den Bereich bieten. Und ich würde sagen, auch Fachbereiche wie Geschichte und Religion werden in digitalen Spielen vorgestellt. Und da geht es nicht darum, zu sagen, so etwas wie „Civilization“ oder „Assassin‘s Creed“ oder so wären historisch akkurate Spiele. Aber auch über eine Form von Medienkompetenz, Forderung von Medienkritik, kann ich bestimmte Fragen stellen oder bestimmte Zusammenhänge in Wirtschaftssimulationen oder in Strategiespielen erläutern, die ich auf jeden Fall spannend finde und wo ich denke, da ist ein Transfer in alle Fachbereiche möglich.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, noch etwas hinzuzufügen. Gibt es etwas, was Sie unseren Hörern noch mitgeben möchten?
Carolin Wendt: Vielleicht einfach die Bitte, etwas Mut zu haben und auch mal etwas auszuprobieren, was man vielleicht bisher nicht gemacht hat oder wo man sich bis jetzt nicht herangetraut hat. Das kann im Umgang mit den Studierenden oder mit den Schülerinnen und Schülern sicherlich eine sehr wertvolle, bereichernde Erfahrung sein.
Maike Groen: Spiele selber spielen und nicht denken, das kann man nur als Jugendlicher machen und danach muss man aber aufhören oder sich dafür schämen. Letzteres ist keine gute Denkrichtung, die aber leider immer noch sehr weit verbreitet ist. Auch wenn auch die Statistiken etwas anderes sagen und auch die aktive Spielerzahl immer älter wird. Ein wichtiger Aspekt für mich wären die Menschen, mit denen man arbeitet, die man bildet, egal wie alt sie sind, ernst zu nehmen und nach ihren Interessen zu fragen, da anzusetzen und so versuchen, den Lerntransfer zu erreichen.
Herzlichen Dank für das Gespräch Ihnen beiden, Frau Wendt und Frau Groen!
Das Interview führte Gabriele Irle, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien (IWM), am 14. Juli 2017.